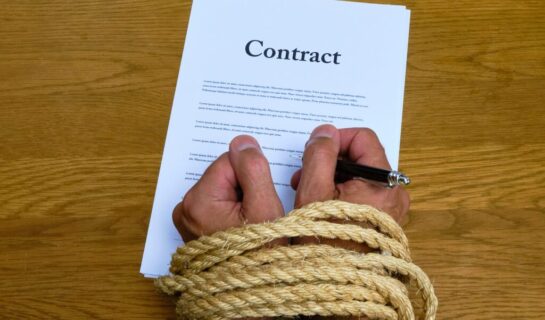Zwei verschiedene Beendigungsmöglichkeiten
Bei Kündigungen sind dem Grunde nach zwei verschiedene Formen zu unterscheiden, die ordentliche und die außerordentliche Kündigung. Trotz der erheblichen Unterschiede der beiden Kündigungsformen dürfen die wesentlichen Gemeinsamkeiten nicht vergessen werden. Als Gestaltungsrechte erfordern beispielsweise sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Kündigung eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Da es jedoch in der Praxis von entscheidender Bedeutung ist, ob eine fristlose oder eine fristgemäße Kündigung vorliegt, müssen die Kündigungsarten und ihre jeweiligen Besonderheiten streng unterschieden werden.
✔ Das Wichtigste in Kürze
- Ordentliche Kündigung: Kein wichtiger Grund nötig; Kündigungsfristen schützen den Arbeitnehmer, um sich an neue Situationen anzupassen.
- Außerordentliche Kündigung: Erlaubt bei wichtigem Grund; keine Kündigungsfrist erforderlich, macht Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar.
- Betriebsbedingte Kündigung: Erfordert dringenden betrieblichen Grund und ordnungsgemäße Sozialauswahl; Arbeitgeber muss Arbeitsplatzwegfall nachweisen.
- Sozialauswahl: Berücksichtigt Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung des Arbeitnehmers bei betriebsbedingten Kündigungen.
- Allgemeiner Kündigungsschutz: Bei Vorliegen genießt der Arbeitnehmer Schutz und es muss ein sozialer Rechtfertigungsgrund für eine ordentliche Kündigung vorliegen.
- Rechtspraxis und Verhältnismäßigkeit: Außerordentliche Kündigungen sind in der Praxis selten und müssen verhältnismäßig sein; ordentliche Kündigungen sind häufiger und weniger streng.
Übersicht:
Die fristlose Kündigung
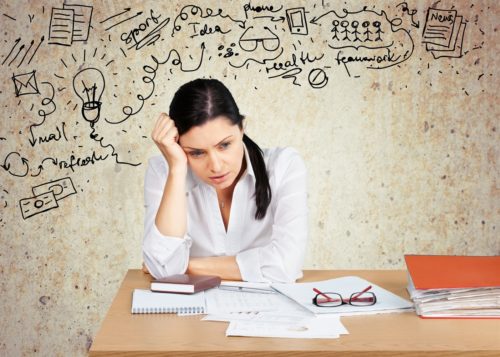
Bei einer außerordentlichen Kündigung muss im Gegensatz zur allgemeinen ordentlichen Kündigung keine Kündigungsfrist eingehalten werden. Aufgrund der Entbehrlichkeit einer Fristeinhaltung wird die außerordentliche Kündigung in der Alltagssprache häufig als fristlose Kündigung bezeichnet. Dabei gibt es durchaus Fälle, in denen einem Arbeitnehmer zwar außerordentlich, aber dennoch mit einer bestimmten Frist gekündigt wird. Eine solche soziale Auslauffrist sind dem Arbeitnehmer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu gewähren.
Weil eine Kündigung mit Auslauffrist eher die Ausnahme darstellt, wird in der Rechtspraxis üblicherweise von der außerordentlichen, fristlosen Kündigung gesprochen. Eine außerordentliche Kündigung ist allerdings nur dann möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der so wichtig sein muss, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Kündigenden unzumutbar geworden ist. Das Vorliegen eines als Kündigungsgrund geeigneten Sachverhalts kann sich aus den verschiedensten Tatsachen ergeben. Anknüpfungspunkt wird in den meisten Fällen ein Fehlverhalten des Arbeitnehmers sein. Grundsätzlich kommen personen- oder verhaltensbedingte Gründe in Betracht. Ebenso kann eine außerordentliche Kündigung aus betrieblichen Gründen erfolgen. Diese ist jedoch nur in Ausnahmefällen zulässig und in der Praxis äußerst selten.
Die ordentliche Kündigung
 Die ordentliche Kündigung hingegen benötigt grundsätzlich keinen wichtigen Grund. Im Rahmen einer ordentlichen Kündigung wird der Arbeitnehmer lediglich in zeitlicher Hinsicht geschützt. Durch die in § 622 BGB normierten Kündigungsfristen soll es dem Empfänger ermöglicht werden, sich ausreichend auf die neue Situation einstellen zu können. Der Arbeitgeber darf also auch ohne besonderen Anlass ordentlich kündigen. Etwas anderes kann sich allerdings ergeben, wenn sich der Arbeitgeber auf den allgemeinen Kündigungsschutz aus dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) berufen kann. In diesem Fall genießt der Arbeitnehmer einen allgemeinen Kündigungsschutz und es muss ein sozialer Rechtfertigungsgrund für eine ordentliche Kündigung vorliegen.
Die ordentliche Kündigung hingegen benötigt grundsätzlich keinen wichtigen Grund. Im Rahmen einer ordentlichen Kündigung wird der Arbeitnehmer lediglich in zeitlicher Hinsicht geschützt. Durch die in § 622 BGB normierten Kündigungsfristen soll es dem Empfänger ermöglicht werden, sich ausreichend auf die neue Situation einstellen zu können. Der Arbeitgeber darf also auch ohne besonderen Anlass ordentlich kündigen. Etwas anderes kann sich allerdings ergeben, wenn sich der Arbeitgeber auf den allgemeinen Kündigungsschutz aus dem Kündigungsschutzgesetz (KSchG) berufen kann. In diesem Fall genießt der Arbeitnehmer einen allgemeinen Kündigungsschutz und es muss ein sozialer Rechtfertigungsgrund für eine ordentliche Kündigung vorliegen.
Die betriebsbedingte Kündigung
Bei diesen Rechtfertigungsgründen wird gemäß § 1 II KSchG zwischen personenbedingten, verhaltensbedingten und betriebsbedingten Gründen unterschieden.

Damit eine betriebsbedingte Kündigung rechtmäßig ist, muss sowohl ein dringender betrieblicher Grund vorliegen als auch eine ordnungsgemäße Sozialauswahl stattgefunden haben. Im Rahmen des dringenden betrieblichen Grundes muss der Arbeitgeber den Nachweis anführen, dass tatsächlich ein konkreter Arbeitsplatz weggefallen ist. Obwohl der Arbeitgeber hierfür die Beweislast trägt, ist die unternehmerische Entscheidung, dass ein Arbeitsplatz weggefallen ist, als solche nur eingeschränkt überprüfbar. Liegt ein dringender betrieblicher Grund vor, so muss anschließend geklärt werden, ob der Arbeitgeber bei der Kündigung eine ordnungsgemäße Sozialauswahl getroffen hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei einer betrieblich veranlassten Kündigung der Arbeitgeber getroffen wird, welcher aus ihr die geringsten Nachteile zu erwarten hat.
Bei der Sozialauswahl muss der Arbeitgeber folgende sozialen Kriterien beachten:
Bei der Sozialauswahl, einem zentralen Element des Arbeitsrechts, muss der Arbeitgeber verschiedene soziale Kriterien berücksichtigen, um eine faire und gerechte Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer zu treffen. Diese Kriterien sind gesetzlich festgelegt und sollen sicherstellen, dass die Kündigung sozial verträglich ist. Hier sind die wichtigsten Kriterien, die bei der Sozialauswahl zu beachten sind:
- Dauer der Betriebszugehörigkeit: Je länger ein Arbeitnehmer im Unternehmen tätig ist, desto mehr Schutz genießt er. Dies berücksichtigt die Loyalität und die investierte Zeit des Arbeitnehmers im Unternehmen.
- Lebensalter: Ältere Arbeitnehmer haben oft weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt und genießen daher einen höheren Kündigungsschutz. Dieses Kriterium trägt dazu bei, ältere Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit zu schützen.
- Schwerbehinderung des Arbeitnehmers: Arbeitnehmer mit einer Schwerbehinderung haben besondere Rechte und einen erhöhten Kündigungsschutz, um Diskriminierung und Benachteiligung am Arbeitsplatz zu verhindern.
- Unterhaltspflichten: Arbeitnehmer, die für den Unterhalt von Familienmitgliedern verantwortlich sind, haben einen erhöhten Schutz vor Kündigungen. Dies berücksichtigt die finanzielle Verantwortung, die diese Arbeitnehmer tragen.
- Wirtschaftliche Situation des Arbeitnehmers: Auch wenn dies nicht explizit genannt wurde, spielt oft auch die wirtschaftliche Situation des Arbeitnehmers eine Rolle. Arbeitnehmer in prekären finanziellen Verhältnissen können einen erhöhten Schutz genießen.
- Berufliche Qualifikation und Leistung: Die Fähigkeiten und die Leistung des Arbeitnehmers können ebenfalls berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin effizient arbeiten kann.
Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass die sozial schwächsten und am stärksten benachteiligten Arbeitnehmer vor den Folgen einer Kündigung geschützt werden und dass die Kündigung sozial gerechtfertigt ist. Es ist wichtig, dass Arbeitgeber diese Kriterien sorgfältig prüfen und abwägen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.