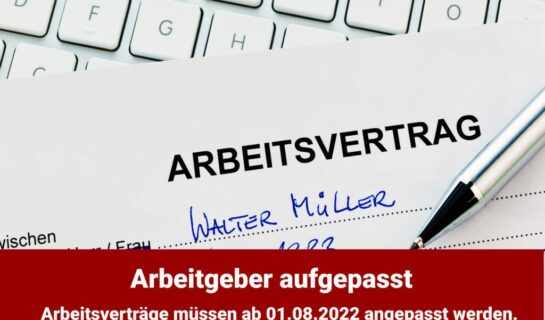Beschränkung der Haftung als Arbeitnehmer
Haftungsfälle im Rahmen des Arbeitsverhältnisses lassen sich auch von den sorgfältigsten Arbeitnehmern nicht vollständig verhindern. Wenn der Arbeitnehmer nun während der Arbeit Schäden am Eigentum des Arbeitgebers verursacht, müsste er nach den allgemeinen Regeln des BGB für die entstandenen Schäden haften. Die Rechtsprechung hat die Schadensersatzpflicht des Arbeitnehmers gegenüber den allgemeinen Regeln der §§ 280 BGB, 276 BGB allerdings erheblich reduziert.

Diese Reduzierung der Haftung liegt in erster Linie an der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers; ein Arbeitnehmer hat in der Regel nicht viel Einfluss auf die Organisation und Abwicklung der Arbeit. Zudem ist der entstandene häufig so groß, dass er in keinem Verhältnis zum Lohn steht. Deswegen wird nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) die Haftung des Mitarbeiters nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs eingeschränkt.
Innerbetrieblicher Schadensausgleich und Umfang der Haftung
Der Begriff des innerbetrieblichen Schadensausgleichs stammt aus dem Arbeitsrecht und soll den Umfang der Arbeitnehmerhaftung regeln. Es ist demnach der Ausgleich von Schäden und Schadensersatzpflichten im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeint. Hierbei wird die Haftung des Arbeitnehmers je nach Grad des Verschuldens eingeschränkt. So haftet der Arbeitnehmer bei leichtester Fahrlässigkeit in aller Regel überhaupt nicht. Kann dem Arbeitnehmer hingegen normale bzw. mittlere Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, wird der Schadensausgleich zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber anhand einer sogenannten Quotelung aufgeteilt. Die Höhe der Quotelung hängt dabei vom Einzelfall ab und richtet sich nach verschiedenen Faktoren. Bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Handeln haftet der Arbeitnehmer hingegen für den vollen Schaden. Eine Ausnahme von der vollen Haftung wird nur gemacht, wenn ein besonders hoher Schaden eingetreten ist und dadurch eine Existenzgefährdung des Arbeitnehmers vorliegt und kein Fall von gröbster Fahrlässigkeit gegeben ist. In einem solchen Fall kann ebenfalls eine Quotelung vorgenommen werden.
Die Fehlgeldentschädigung

Eine spezielle Form der Haftung des Arbeitnehmers ist die sogenannte Mankoabrede, die in den Fällen von Fehlgeldentschädigungen zum Einsatz kommen kann. häufig stellt sich für den Arbeitgeber die Frage, wie er mit Fehlbeständen einer Kasse umgehen soll. Für solche vom Arbeitnehmer zu verantwortenden Schäden hat sich der Begriff der Mankohaftung herausgebildet. Die Haftung des Arbeitnehmers kann sich entweder aus einer speziellen Mankoabrede oder aus den allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätzen ergeben. Eine Mankoabrede kann dazu führen, dass die betroffenen Arbeitnehmer für alle Differenzbeträge in der Kasse selbst haften müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dem Angestellten ein Verschulden am Fehlbetrag nachgewiesen werden kann oder nicht. Eine Mankoabrede ist jedoch nur wirksam, wenn sie hinsichtlich des Umfangs der Haftung klar und eindeutig gefasst wurde. Darüber hinaus muss der Mitarbeiter für das zusätzlich übernommene Haftungsrisiko einen angemessenen wirtschaftlichen Ausgleich, die so genannte Fehlgeldentschädigung, erhalten. Dabei ist diese Mankoabrede nur zulässig, wenn dem Arbeitnehmer durch sie allein die Chance einer zusätzlichen Vergütung für die erfolgreiche Verwaltung eines Kassen- oder Warenbestandes bekommt.
Die Darlegungs- und Beweislast bei Mankoabreden
Ohne Bestehen einer Mankovereinbarung haftet ein Arbeitnehmer nur, wenn eine schuldhafte Verletzung des Arbeitsvertrags oder eine unerlaubte Handlung vorliegt. Der Arbeitgeber muss demnach eine Pflichtwidrigkeit des Arbeitnehmers, einen durch den Arbeitnehmer verursachten Schaden sowie dessen Verschulden beweisen. Dem pflichtwidrigen Verhalten muss zudem eine mittlere Fahrlässigkeit zugrunde liegen. Im Falle einer wirksamen Mankoabrede muss der Arbeitgeber lediglich beweisen, dass der Angestellte die alleinige Verfügungsgewalt über die betreffende Kasse hatte.